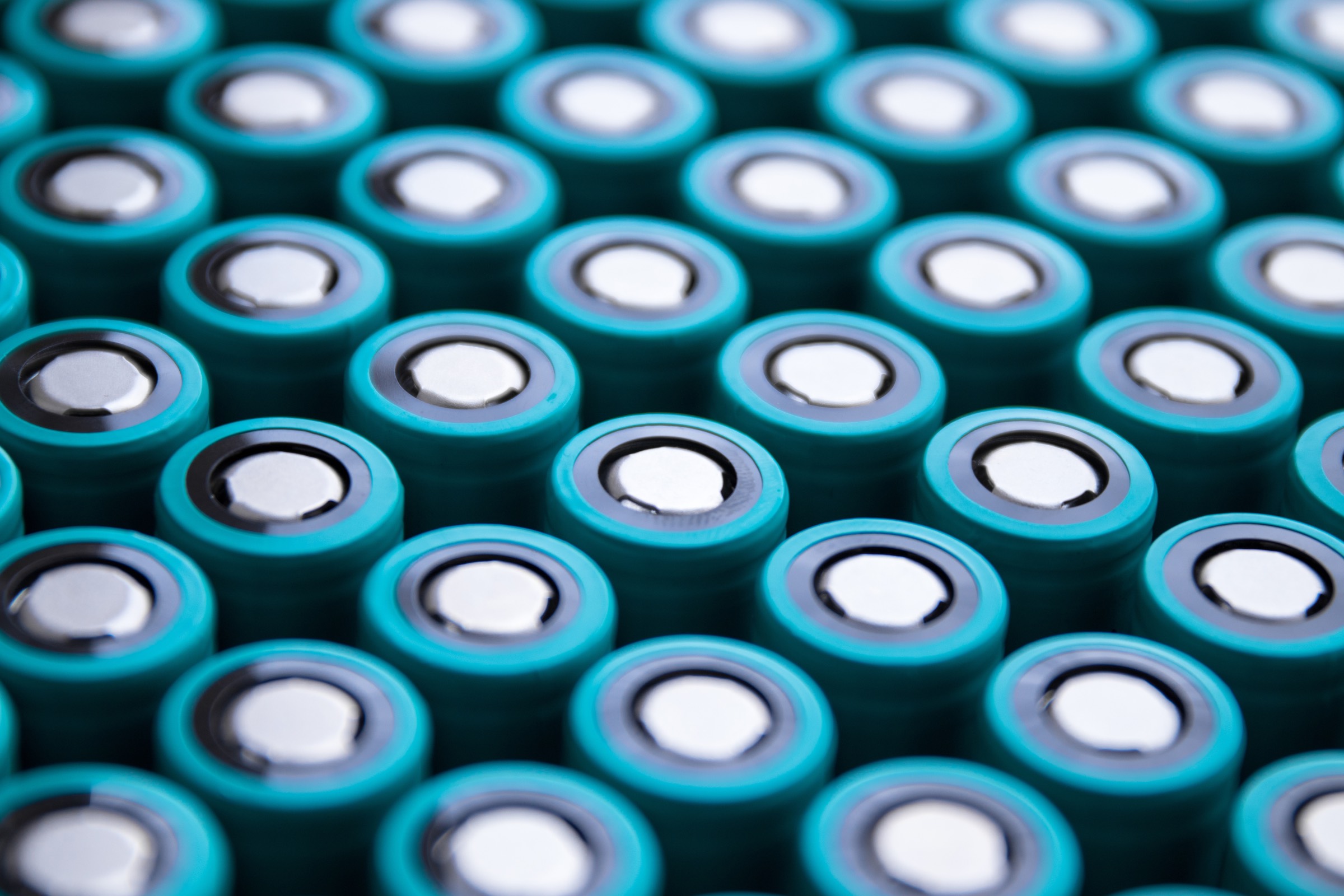Die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV) und die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) regeln die Nachhaltigkeitsanforderungen für Biokraftstoffe und andere Biomassebrennstoffe sowie die Stromerzeugung aus Biomasse. Beide Gesetze dienen der nationalen Umsetzung der „Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen“ (Erneuerbare-Energien-Richtlinie – RED II). Letztere wurde zum 20. November 2023 durch die Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED III) geändert, was wiederum eine Anpassung beider Verordnungen erfordert. Ein entsprechender Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) liegt seit Mitte August vor. Abfallmanager Medizin wirft einen Blick auf die zu erwartenden Neuerungen und zeigt, welche Relevanz nachhaltige Energieträger für Krankenhäuser haben.
Neben der vollständigen Umsetzung der Änderungen durch die RED III nimmt die Novelle vor allem eine verpflichtende Akkreditierung von Zertifizierungsstellen durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) sowie eine verbesserte Betrugsprävention in den Fokus. So erweitert der Entwurf etwa den Umfang von Kontrollen, die Behördenbefugnisse zur Probeentnahme in Verdachtsfällen sowie den Ordnungswidrigkeitenkatalog der Verordnungen.
Anwendungsbereich und Treibhausgasemissionen
Künftig sollen gemäß Entwurf bereits Biomasseanlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 7,5 Megawatt der BioSt-NachV unterliegen. Zuvor waren nur weitaus größere Anlagen ab einer Leistung von 20 Megawatt betroffen. Zukünftig möchte man gestaffelt ausdrücklich auch Bestandsanlagen mit Leistungen von zehn Megawatt und weniger in die Pflicht nehmen. All diese Kraftwerke müssen zudem bis 2030 eine Treibhausgaseinsparung von mindestens 80 Prozent erreichen.
Neue Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und Biomasse
Die Nachhaltigkeitskriterien werden insbesondere für Biokraftstoffe deutlich verschärft: Diese dürfen demnach nicht mehr aus Alt- und Primärwäldern, Heideland oder Torfmooren gewonnen werden. Gleichsam gelten höhere Anforderungen an forstliche Biomasse. Eine nachhaltige Walderneuerung sowie der Schutz von Böden und Biodiversität werden zur Pflicht, Kahlschläge hingegen verboten. Hierzu ist zudem eine Zuverlässigkeitserklärung der Schnittstellen (hier Biomassehersteller) auszustellen, in der bestätigt wird, dass die forstwirtschaftliche Biomasse nicht von solchen geschützten Flächen stammt. Biokraftstoffe aus heimischer Forstbiomasse sollen in Zukunft nur noch gefördert werden, wenn ihre Herstellung mit den Klimazielen für Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) sowie den integrierten nationalen Energie- und Klimaplänen vereinbar ist. Gleichzeitig muss der Wald dabei als Kohlenstoffsenke mindestens erhalten beziehungsweise optimalerweise ausgebaut werden. Biokraftstoffe sollen demnach nur noch ergänzend unter Berücksichtigung der nationalen Klima- und Waldschutzverpflichtungen genutzt werden und diese zugleich unterstützen.
Akkreditierung von Zertifizierungsstellen
Zertifizierungsstellen, die für die Überprüfung der Nachhaltigkeits- und Treibhausgasvorgaben bei Biokraftstoffen und Strom-Biomasse zuständig sind, bedürfen laut dem Referentenentwurf künftig einer verpflichtenden Akkreditierung. Diese hat ab dem 1. Januar 2027 bei der Deutschen Akkreditierungsstelle zu erfolgen. Bei erstmaliger Akkreditierung gilt diese vorläufig für maximal zwölf Monate. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Ferner ist eine Registrierung von Zertifizierungsstellen im EU-Ausland und außerhalb vorgesehen.
Überwachung und Kontrollen
Falsch deklarierter Biokraftstoff aus dem Ausland untergräbt die deutschen Klimaziele und schadet darüber hinaus dem Kraftstoffmarkt. Um dies stärker zu unterbinden, wird der Umfang der Kontrollen weiter präzisiert und ausgeweitet. Dies umfasst:
- die Festlegung von Stichprobenarten, behördlichen Befugnissen sowie einer Pflicht zur Probenentnahme,
- jährliche, „repräsentative“ Kontrollen der Schnittstellen,
- Befugnisse der DAkkS zu unangekündigten Überprüfungen der anerkannten Zertifizierungsstellen sowie
- behördliche Anordnungen von Probenentnahmen und Laboranalysen durch die Zertifizierungsstelle bei begründetem Verdacht auf Art und Herkunft der deklarierten Biomasse.
Verbesserte Betrugsprävention
Zur besseren Betrugsprävention werden erweiterte Prüfpflichten bei Schnittstellen und Lieferanten eingeführt, mit klaren Anforderungen an das Massenbilanzsystem. Auch fällt die frühere Regelung der „Anerkennung trotz Unwirksamkeit“ weg. Fehlerhafte und dementsprechend nicht wirksame Nachhaltigkeitsnachweise sollen damit nicht länger anerkannt werden. Werden diese Nachweise binnen drei Jahren nicht genutzt oder eingereicht, gelten sie zudem künftig als ungültig.
Prüfungsfristen und erweiterte behördliche Befugnisse
Nach Kontrollabschluss muss die Zertifikatserteilung in Zukunft innerhalb von 60 Tagen erfolgen. Bei einer Erneuerung der Zertifizierung beträgt die maximale Frist sechs (BioSt-NachV) beziehungsweise drei Monate (Biokraft-NachV). Die zuständigen Behörden erhalten indes erweiterte Anordnungsbefugnisse sowie unmittelbare Kontrollrechte. Diese umfassen unter anderem:
- Witness Audits (unabhängige „Überprüfungen von Überprüfungen“),
- die Möglichkeit des sofortigen Entzugs von Zertifikaten bei Verstößen und
- einen erweiterten Widerrufsrahmen für Anerkennungen von Zertifizierungsstellen (etwa bei fehlender Mitwirkung vor Ort oder Auskunftsverweigerung).
Ordnungswidrigkeiten, Sanktionen und Übergangsfristen
Auch der Ordnungswidrigkeitenkatalog wird durch die Novelle von Biokraft-NachV und BioSt-NachV deutlich erweitert. Geahndet werden demnach etwa die Ausstellung unberechtigter Zertifikate, die Nutzung unwirksamer Nachhaltigkeitsnachweise sowie Verstöße gegen Mitwirkungspflichten.
Bislang anerkannte Zertifizierungsstellen behalten laut dem Referentenentwurf bis zum 31. Dezember 2026 ihre Gültigkeit, sofern das neue Akkreditierungsverfahren beantragt wurde. Ab dem 1. Januar 2027 gilt dann endgültig die Pflicht zur Akkreditierung über die DAkkS.
Warum Biokraftstoffe und Biomassenstrom für Krankenhäuser wichtig sind
So weit die möglichen Änderungen für Biokraft-NachV und BioSt-NachV. Doch was hat das eigentlich mit Krankenhäusern zu tun? Kurzum: Es geht um nachhaltige Energieerzeugung. Kliniken benötigen große Mengen Energie. Den Energieverbrauch zu reduzieren, ist aber nur begrenzt möglich, da ihr Dauerbetrieb lebenswichtig ist. Der Weg zu einem ressourcenschonenderen Krankenhausbetrieb kann aber beispielsweise mithilfe von erneuerbaren Energien realisiert werden. Hier spielen Biokraftstoffe und Biomassenstrom eine wichtige Rolle, denn mit Solarenergie und Windkraft allein ließe sich der enorme Wärmeenergie- und Strombedarf kaum decken. Mittlerweile werden daher nicht wenige Krankenhäuser in Deutschland über Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Strom und Wärme versorgt, die Biomasse oder Biokraftstoffe zur Energieerzeugung nutzen.
Eines der ersten Krankenhäuser, das auf Biomasse setzte, ist das Bezirksklinikum Mainkofen. Hier wird bereits seit 2004 über ein lokales BHKW mit Kraft-Wärme-Kopplung geheizt und elektrifiziert. Das kleine Kraftwerk läuft mit Hackschnitzeln und deckt den jährlichen Wärmebedarf des Klinikums von 20 Millionen Kilowattstunden. Eine nachgeschaltete Turbine erzeugt zusätzlich Strom für die mehr als 90 Gebäude des Standorts. Weitere ähnliche Beispiele sind das Kreiskrankenhaus Heppenheim (Biomasseheizanlage, ergänzt durch Biomethan-BHKW), das Klinikum Augsburg (Holzhackschnitzelanlage) und das Fachkrankenhaus Bethanien Hochweitzschen (Biogas-BHKW).
Wichtig ist allerdings, dass die verwendete Biomasse oder die genutzten Biokraftstoffe aus nachhaltigen Quellen stammen. Genau darauf zielen die Nachhaltigkeitsverordnungen für Biokraftstoffe und Biomassenstrom ab.