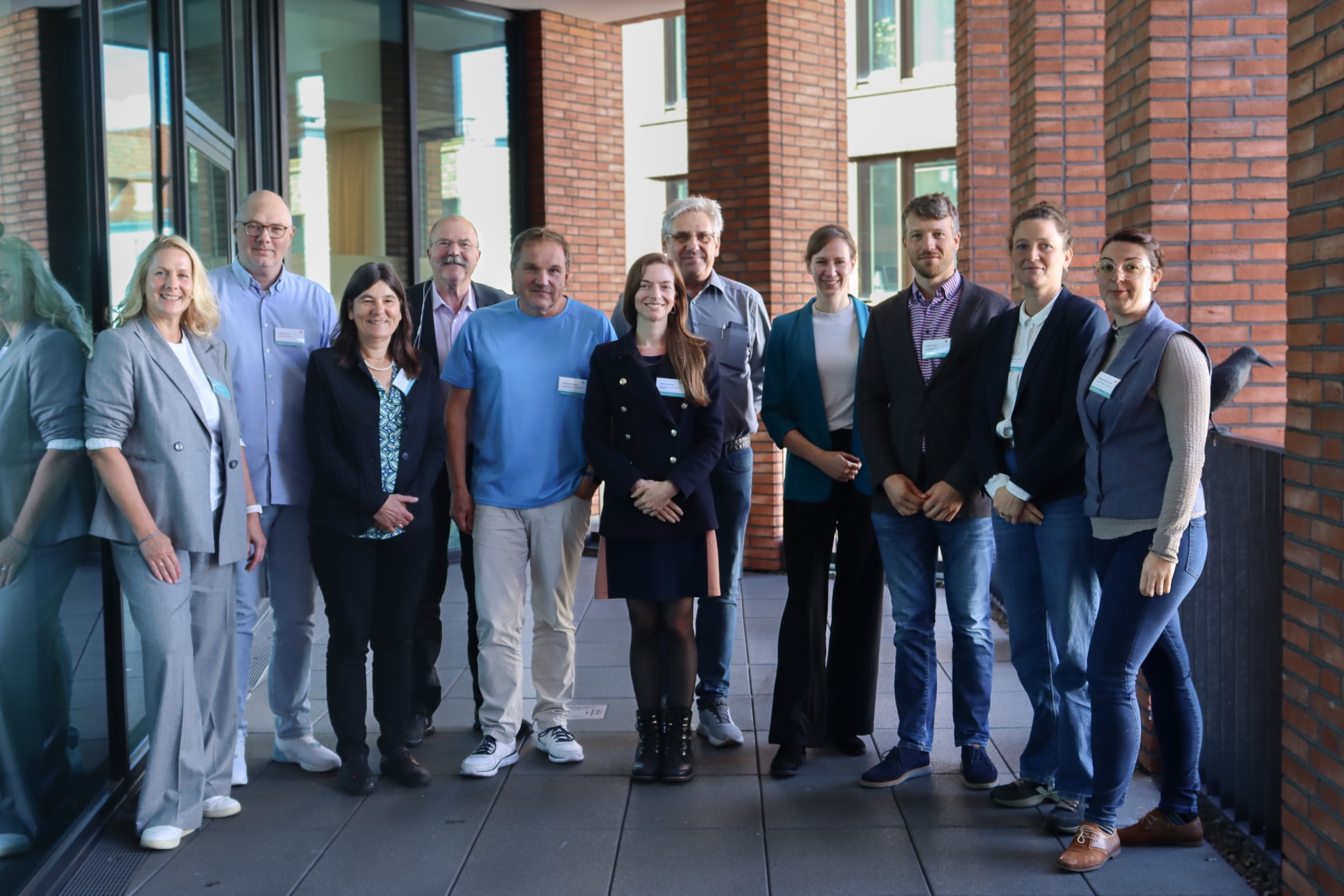Unappetitlich, geschmacklos, zu kleine Portionen – die Speisenversorgung in deutschen Krankenhäusern hatte über Jahre hinweg einen schlechten Ruf. Und auch heute entspricht das in einigen Häusern noch der Realität. Trotz allem kommt zunehmend Bewegung in deutsche Krankenhausküchen: Immer mehr Einrichtungen bemühen sich, Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende mit gesunden und schmackhaften Speisen zu versorgen und auch mit Vorurteilen aufzuräumen, die sich hartnäckig in den Köpfen halten. Gleichzeitig trägt eine moderne Speisenversorgung aktiv dazu bei, um Kliniken ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig aufzustellen.
Eine ausgewogene Ernährung ist von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen und trägt aktiv zur Genesung bei. Obwohl diese Zusammenhänge bereits seit längerem bekannt sind, zeigt sich erst seit Kurzem eine deutliche Verbesserung der Verpflegung in Kliniken und anderen Gesundheitseinrichtungen. Anpassungen an den Speiseplänen haben zusätzlich auch einen Einfluss auf die Umwelt. Eine aktuelle Studie des Drawdown Projects zeigt beispielsweise, dass Privathaushalte mit der Reduzierung von Speiseabfällen sowie der Umstellung auf eine pflanzenreiche Ernährung ihre CO2-Emissionen deutlich reduzieren können. Das lässt sich auch auf die Gemeinschaftsversorgung in Universität, großen Unternehmen oder Krankenhäusern übertragen, denn hier werden nach Schätzung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung täglich bis zu 18,3 Millionen Menschen verpflegt. Damit hat die Gemeinschaftsgastronomie einen großen Einfluss auf die tägliche Ernährung in Deutschland, kann aufklären und neue Impulse in den Speiseplan all derjenigen bringen, die in den Einrichtungen versorgt werden.
Planetary Health Diet: Vorteile für Klima, Gesundheit und Finanzen
Ackerflächen für den Anbau von Getreide- und Nutzpflanzen, Weidefläche für die Tierhaltung sowie Wasser zur Bewässerung – die Ressourcen der Erde zur Produktion von Lebensmitteln sind begrenzt. Und auch das zunehmende Bevölkerungswachstum zeigt deutlich, dass gerade bei der Ernährung Ressourcen eingespart werden müssen. Aus diesem Grund haben Forschende der EAT-Lancet-Kommission 2019 das Konzept der „Planetary Health Diet“ (PHD) entwickelt. Hier stehen tierische Produkte nur noch optional auf dem Speiseplan, pflanzliche Proteinquellen sind ausdrücklich empfohlen. Die PHD sieht dabei keine strikte Ernährungsform wie die vegetarische oder vegane Ernährung vor, was sie besonders für die sogenannten Flexitarier attraktiv macht. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine vorwiegend pflanzliche Kost: Mit 75 Prozent pflanzlichen und knapp 25 Prozent tierischen Lebensmitteln. Neben den zahlreichen Vorteilen für die Umwelt, reduziert sich mit einer pflanzenbasierten Ernährung auch das Risiko an verschiedenen Herz-Kreislauf-Störungen, Adipositas oder Typ-2-Diabetes zu erkranken. Diese gehören vor allem in Industrieländern zu den verbreitetsten Volkskrankheiten und gehen mit einer hohen Mortalitätsrate einher.
Ein weiterer Pluspunkt: Bei der Versorgung mit einem überwiegenden Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln wie Linsen, Kichererbsen oder Soja-Produkten ist der Warenwert im Vergleich zu einer fleischreichen Ernährung deutlich geringer. Auch der Einkauf von Produkten in Bioqualität ist mit pflanzlichen Produkten im Vergleich oft kostengünstiger zu realisieren. Gerade zunehmende Lebensmittelpreise sowie steigende Personalkosten machen eine pflanzenbasierte Ernährung aus wirtschaftlicher Perspektive für Kliniken attraktiv.
Foodwaste: Ein großes Problem in Krankenhäusern
Große Mengen an Lebensmittelabfällen gehören in der Gemeinschaftsversorgung zum Alltag. Laut einer Umfrage des Deutschen Krankenhaus Instituts (DKI) aus dem Jahr 2019 fallen pro Krankenhausbett durchschnittlich 230 Kilogramm Kantinen- und Küchenabfälle im Jahr an. Das liegt laut DKI vor allem an den anfallenden Speiseresten pro Gericht sowie den Tellerrückläufen. Aber auch fehlende Möglichkeiten, kurzfristig Anpassungen am Speiseplan vorzunehmen und die geringe Haltbarkeit von Lebensmitteln sorgen dafür, dass viele Kliniken übermäßig viele Lebensmittel entsorgen müssen. Einen großen Einfluss auf die Zahl der Lebensmittelabfälle hat auch die Küchenorganisation.
Kliniken können hier zwischen einer konventionellen, entkoppelten und einer Systemküche wählen. Durch die Kühl- und Gefriermöglichkeiten sind gerade die letzten beiden Organisationsformen flexibler: Die hier verwendeten Lebensmittel sind in der Regel länger haltbar und können bei Bedarf einfacher portioniert werden. Auch Anpassungen der Personenzahlen sind weniger problematisch – das trägt zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen bei. Die Entscheidung für eine der Küchenorganisationen ist immer von verschiedenen Faktoren wie personellen und finanziellen Ressourcen abhängig.
Digitale Softwarelösungen können Kliniken ebenso unterstützen, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und den Speiseplan zu optimieren. Mit diesen Tools kann die Küchenleitung Menüpläne erstellen, Nährwerte berechnen und den gesamten Einkauf abwickeln. Mittlerweile gibt es verschiedene Cateringunternehmen, die Komplettlösungen anbieten, Kliniken eine gewisse Planungssicherheit versprechen und so dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung und damit auch die Menge an Speiseabfällen zu minimieren.
Verpackungsabfälle aus Cafeteria und Kiosk im Krankenhaus
In der Novelle des Verpackungsgesetzes ist beispielsweise auch das Verbot bestimmter Verpackungsarten – u. a. Einzelportionen für Kaffeesahne, Zucker oder Marmeladen – vorgesehen, die in vielen medizinischen Einrichtungen beim Frühstück ausgegeben oder in Kiosk oder Kantine verkauft werden. Zudem steht auch die Wiederverwendbarkeit von Verkaufs- und Transportverpackungen stärker im Fokus und Pfand- bzw. Rücknahmesysteme sollen Abhilfe schaffen, Verpackungsabfälle zu reduzieren. Kliniken müssen für verschiedene Verpackungen nachhaltige Alternativen anbieten und die Speisenversorgung dahingehend umstellen, dass dem Verpackungsgesetz Folge geleistet wird und gleichzeitig die Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeitenden sichergestellt ist.
Entsorgung und Verwertung von Speiseabfällen
Die Entsorgung von Lebensmittelresten spielt im Krankenhaus eine große Rolle: Um mögliche Infektionen mit Lebensmittelkeimen oder Salmonellen bei den meist stark angeschlagenen Patientinnen und Patienten zu vermeiden, sind die Hygienestandards im Gesundheitswesen sehr hoch. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaus-Hygiene e.V. hat deshalb „Hygieneanforderungen im Umgang mit Lebensmitteln in Krankenhäusern, Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen und neuen Wohnformen“ festgelegt, die auch klare Empfehlungen für das Entsorgungsmanagement definieren. Darunter fällt beispielsweise eine strikte Abfalltrennung und die Abgabe von Speiseabfällen an zertifizierte Entsorgungsbetriebe.
Speisereste werden in Deutschland gemäß Abfallschlüssel 20 01 08 als biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle klassifiziert und gelten gemäß Abfallrecht als Wertstoffe. Die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) schreiben vor, dass gewerbliche Küchen- und Speiseabfälle getrennt zu sammeln sind und in einer zugelassenen Biogas- oder Kompostieranlage verwertet werden müssen. Zudem sind Lebensmittelabfälle aus tierischer Herkunft gemäß der Mitteilung der Bund-/Länder-Gemeinschaft Abfall (LAGA) 18 getrennt von anderen Abfällen zu sammeln, bevor Kliniken sie einem zertifizierten Entsorger übergeben.
Nach der 6. gemeinsamen Care-Studie des Deutschen Krankenhausinstituts und der K&P Consulting nutzten 2022 knapp die Hälfte der 453 befragten Allgemeinkrankenhäuser 120-Liter-Tonnen, um ihre Nassabfälle – sprich Speisereste – zu entsorgen. Weitere 129 Kliniken verwenden größere Tonnen mit einem Fassungsvermögen von 240 Litern. Die Abfälle werde vom Entsorger in regelmäßigen, individuell festgelegten Intervallen abgeholt. Einen solchen Service bietet beispielsweise das Unternehmen ReFood an und bereitet seit über 30 Jahren in 22 Anlagen deutschlandweit organische Reststoffe zu nachhaltigen Energiequellen auf. Lebensmittel, Knochen und Fleischreste werden in Biogasanlagen zu nährstoffreichen Gärprodukten verarbeitet, aus denen ReFood Ökostrom, Biomethan, Wärme oder organischen Dünger erzeugt. Fettabscheiderinhalte, Alt- und Frittierfette nutzt das Unternehmen zur Herstellung von Biodiesel.
Nachhaltigkeitsberichterstattung bezieht auch Speisenversorgung und Lebensmittelabfälle ein
Die Europäische Union hat am 26. Februar mit dem Entwurf des Omnibus-Pakets weitreichende Änderungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung und -verpflichtungen vorgeschlagen, welche eine deutliche Verschlankung der CSRD durch die Einführung einer neuen Größenklasse vorsieht. Nach dem Vorschlag sollen zukünftig nur Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und einem Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro bzw. einer Bilanzsumme von 25 Millionen Euro berichtspflichtig sein. Bis dato galt die Pflicht für Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, einer Bilanzsumme von über 20 Millionen Euro oder einem Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro. Aktuell fehlt allerdings noch die Umsetzung in die deutsche Gesetzgebung, dies muss durch die Bundesregierung realisiert werden. Vom vorgelegten Omnibus-Paket sollen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen profitieren und auch viele Kliniken wären so nicht weiter berichtspflichtig.
Ein Aspekt, der im Rahmen der Berichterstattung aufzuarbeiten ist, sind Maßnahmen im Bereich Umwelt, Nachhaltigkeitsstrategie und -management. Darunter fällt auch die Speisenversorgung einschließlich der Entsorgung und Reduktion von Lebensmittelabfällen. Die Verpflegung ist dabei für etwa 17 Prozent der Emissionen einer Klinik verantwortlich. Gerade das Erfassen der Rohstoffnutzung in der Küche kann aktiv dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelabfälle zu reduzieren, was sich sowohl in den Treibhausgasemissionen als auch in den Kosten widerspiegelt. Aktuelle Zahlen aus der BDO/DKI-Studie 2024 zum Thema „Nachhaltigkeitsberichterstattung in Krankenhäusern“ belegen allerdings, dass sich 22 Prozent der befragten Einrichtungen bis dato nur eingeschränkt bzw. überhaupt nicht mit dem Thema nachhaltige Speisenversorgung beschäftigt haben.
Optimierte Speisenversorgung für eine effiziente Ressourcennutzung
Die Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden kann entscheidend dazu beitragen, um in Kliniken Ressourcen, Abfälle und auch bares Geld einzusparen. Aus diesem Grund rückt in vielen Kliniken das Thema immer stärker in den Vordergrund und ist ein wichtiges Instrument, mit dem sich Einrichtungen aus ökologischer, ökonomischer und auch sozialer Ebene langfristig nachhaltig aufstellen können. Denn neben den klaren Vorteilen einer gesunden, vollwertigen und fleischreduzierten Ernährung für die Gesundheit und das Wohlbefinden, können mit Anpassungen der Ver- und Entsorgung gleichzeitig ökologische und ökonomische Ressourcen eingespart werden.